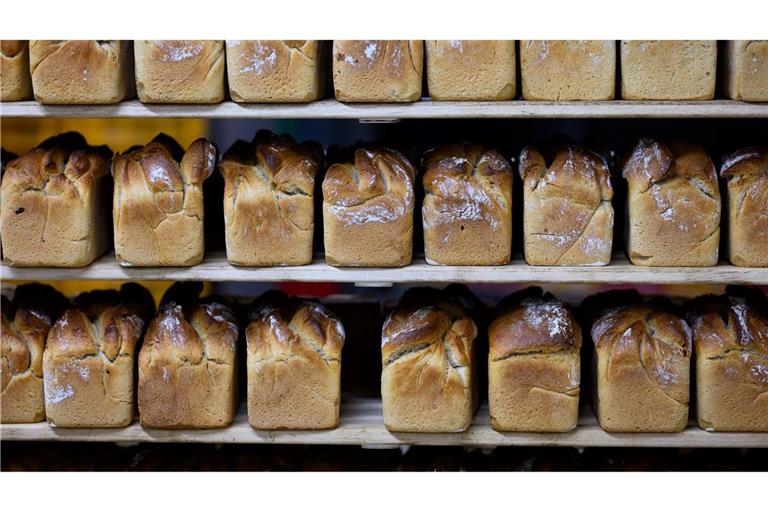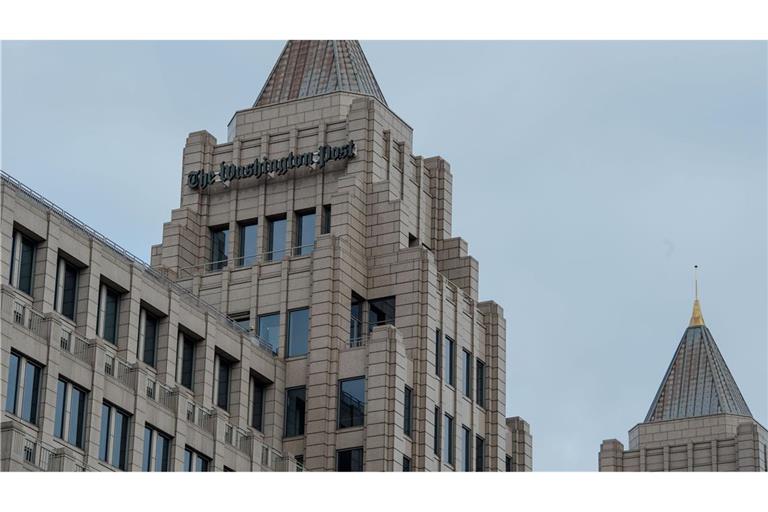Brandbrief an EU-Kommission
Autoindustrie: „Letzte Chance der EU, Politik an die Realitäten anzupassen“
In einem Brief an EU-Präsidentin Ursula von der Leyen fordern die Verbandschefs Ola Källenius (Mercedes) und Matthias Zink (Schaeffler) grundlegende Korrekturen beim Klimaschutz.

© dpa
Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius dringt bei der EU-Kommission auf Änderung der CO2-Vorgaben.
Von Matthias Schmidt
Die europäische Autoindustrie stemmt sich in einem Brandbrief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegen die Klimaschutzvorgaben der EU. „Wir sind frustriert über das Fehlen eines ganzheitlichen und pragmatischen politischen Plans für den Wandel der Automobilindustrie“, schreiben Mercedes-Chef Ola Källenius und Matthias Zink, Chef der Antriebssparte bei Schaeffler, in ihren Funktionen als Präsidenten der europäischen Verbände der Autohersteller (Acea) und Zulieferer (Clepa).
Im Vorfeld eines Treffens zum Strategischen Dialog mit der Kommission am 12. September sprechen sie in dringlichem Ton von „der letzten Chance der EU, ihre Politik an die heutigen Markt-, geopolitischen und wirtschaftlichen Realitäten anzupassen“. Andernfalls ginge sie das Risiko ein, „eine ihrer erfolgreichsten und global wettbewerbsfähigsten Branchen zu gefährden“.
Kernforderungen des am Mittwoch veröffentlichten Briefs sind Anreize zum Umstieg auf Elektromobilität sowie die Änderung der CO2-Regularien, die der Industrie im Rahmen des Green Deals gemacht wurden. Dazu zählt unter anderem, dass von 2035 an nur Autos neu zugelassen werden dürfen, die im Betrieb kein klimaschädliches CO2 produzieren, was in der öffentlichen Debatte unter dem Stichwort „Verbrennerverbot“ diskutiert wird. Zudem drohen Strafzahlungen bei Überschreiten gewisser Grenzwerte auf dem Weg dorthin.
Die Autoindustrie hält die CO2-Ziele für unrealistisch
„Die starren CO₂-Ziele für Pkw und Transporter für 2030 und 2035 sind unter heutigen Bedingungen schlicht nicht mehr realistisch“, so Källenius und Zink. Stattdessen müsse der aktuelle CO2-Minderungspfad im Straßenverkehr neu kalibriert werden, „um die Klimaziele der EU zu erreichen und gleichzeitig Europas industrielle Wettbewerbsfähigkeit, sozialen Zusammenhalt und die strategische Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu sichern“.
Die Autoindustrie stelle das EU-Ziel der Dekarbonisierung bis 2050 nicht in Frage, heißt es in dem Brief. Man habe Hunderte von Elektroautos entwickelt und investiere bis 2030 gemeinsam über 250 Milliarden Euro in die Transformation. Die EU hingegen versäume es, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Kritik im Wortlaut:
- „Europa ist nahezu vollständig abhängig von Asien in der Batterie-Wertschöpfungskette
- Die Ladeinfrastruktur ist ungleich verteilt
- Wichtige Handelspartner belasten uns mit Zöllen, etwa dem 15-prozentigen Einfuhrzoll auf EU-Fahrzeuge in die USA.“
„Wir sollen transformieren – mit gefesselten Händen“
Die Automanager ziehen daraus das Fazit: „Wir sollen uns transformieren – mit gefesselten Händen.“ Um der Elektromobilität bei den Verbrauchern zum Erfolg zu verhelfen, bedürfe es langfristiger Anreize, argumentieren sie, „darunter niedrigere Energiekosten fürs Laden, Kaufzuschüsse, Steuererleichterungen und bevorzugter Zugang zu urbanem Raum“. Zudem sollten auch andere Antriebstechnologien erlaubt bleiben, darunter Plug-In-Hybride und Elektroautos mit (verbrenner-gestütztem) Reichweitenverlängerer sowie hocheffiziente Verbrenner, Wasserstoff-Antriebe und dekarbonisierte Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels.
Die Forderungen der Industrie, wesentliche Regeln der Klimaschutzpolitik zu ändern, sind nicht gänzlich neu. Selten wurden sie jedoch so dringlich vorgetragen wie jetzt im Hinblick auf den „Strategischen Dialog“ in Brüssel. Es sei inzwischen klar, „dass Sanktionen und gesetzliche Vorgaben allein die Transformation nicht vorantreiben werden“, so die Industrieverbände.
Klimaschutzpolitiker hingegen befürchten, dass ein Aufweichen der Vorgaben dazu führen wird, dass der Hochlauf der Elektromobilität weiter eingebremst wird – und Investitionen in die neue Technik, beispielsweise in Ladesäulen- und Stromnetzausbau, sich ebenfalls verlangsamen oder unrentabel bleiben.