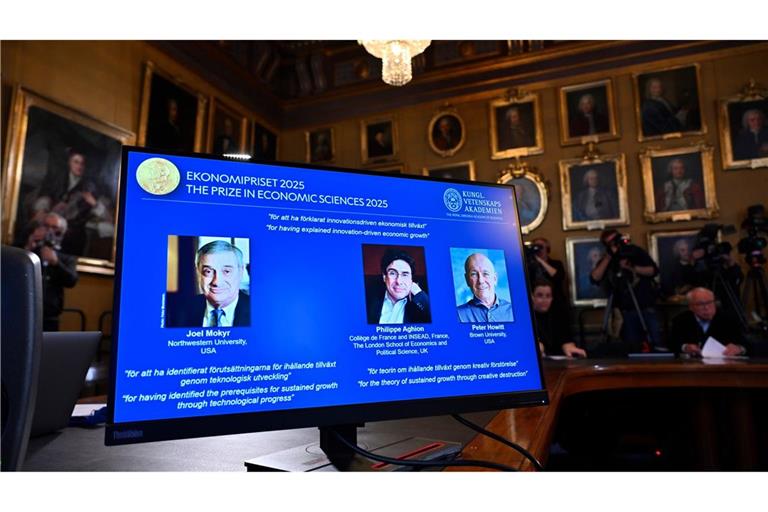Grenzbereiche
Die Bodenseeregion bangt um die EU-Förderung
Brüssel will die Vergabe der Regionalförderung neu ordnen. Für wirtschaftsstarke Grenzregionen wie am Bodensee könnte dieser Schritt das Aus für manche Projekte bedeuten.

© Felix Kästle/dpa
Konstanz ist stark von der EU-Strukturpolitik betroffen.
Von Knut Krohn
Florian Haßler ahnt nichts Gutes. Grund für seine Sorge ist die geplante Neuausrichtung der Strukturpolitik in der Europäischen Union. Das hört sich EU-typisch kompliziert an, weshalb der Europastaatssekretär von Baden-Württemberg am Donnerstag bei einem Besuch auf dem Innovationsareal Bücklepark in Konstanz immer wieder die möglichen Folgen der Regelung beschreibt – denn die könnten vor allem für europäische Grenzregionen fatal sein. Der Bodenseeraum sei ein Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, die zukunftsfähige Entwicklungen in vielen Bereichen erst möglich mache, betont Haßler. Er befürchtet, dass die EU – wenn auch ungewollt - hier viele Probleme bereiten könnte.
Ursprung der Sorgen ist der Vorschlag der EU-Kommission für den nächsten EU-Haushalt von 2028 bis 2034, der jüngst vorgestellt wurde. Mit knapp zwei Billionen Euro ist er deutlich höher als das vorige Budget und legt wie erwartet den Schwerpunkt auf die Wettbewerbsfähigkeit. Bis zum Inkrafttreten des sogenannten Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) wird über dessen Ausgestaltung noch intensiv verhandelt werden, auch über Kürzungen bei Regionalförderung.
Anträge werden nicht mehr direkt eingereicht
Die grundlegende Änderung, vor der Florian Haßler warnt, sind die neuen Verteilungswege der Fördermittel. Konnten sich die grenzüberschreitenden Regionen bisher in einem Antrag gemeinsam direkt an Brüssel wenden, soll das in Zukunft den Umweg über die Hauptstädte gehen. Das bedeutet für den Bodenseeraum, dass ein EU-Projekt im Extremfall in Berlin und Wien eingereicht werden muss und dann noch zusätzlich in Bern und Vaduz – die vier Hauptstädte müssten sich dann getrennt für eine Förderung an Brüssel wenden.
Genährt werden die Bedenken noch durch die umständliche Methode der Mittelvergabe. Denn um Geld aus dem zukünftigen Fonds zu erhalten, muss jeder EU-Staat zuvor einen sogenannten Nationalen Reform- und Investitionsplan (NRP) erstellen. Darin würde die Regierung darlegen, welche Reformen und Investitionen es von 2028 bis 2034 umsetzen will und wofür es EU-Geld verwenden möchte. „Diese Zentralisierung der Strukturpolitik wird zu mehr Verwaltungs- und Koordinierungsaufwand führen“, befürchtet Haßler. „Der Vorschlag der Kommission hebelt die bewährten Partnerschaften zwischen der Kommission und den Regionen aus.“ Er betont, dass die Regionen selbst ihre Bedürfnisse am besten kennen und benennen würden.
Die Struktur der Mittelverwaltung erhalten
In Brüssel zu Wort gemeldet hat sich aus diesem Grund auch schon die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK), die politische Vertretung der im Bodenseeraum zusammenarbeitenden Regionen. Sie vertritt rund 4,3 Millionen Einwohner mit einem Bruttosozialprodukt von 330 Milliarden Euro. Das sei „vergleichbar mit den Volkswirtschaften von Rumänien oder Finnland“, betont die IBK in einer jüngst an Brüssel gerichteten gemeinsamen Erklärung. Darin wird gefordert, dass „die bewährte Struktur der Mittelverwaltung“ in der EU erhalten werden müsse. Eine Zentralisierung sei abzulehnen, da sie „die Förderung grenzüberschreitender Projekte erheblich erschweren und im schlimmsten Fall ganz verhindern“ würde, da „nationale Pläne oft nicht aufeinander abgestimmt sind“.
Ungemach droht der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Bodenseeregion allerdings nicht nur von Seiten der EU. In der IBK sind auch sechs Schweizer Kantone organisiert, doch die Stimmung gegenüber der Europäischen Union ist im Moment aufgeheizt. Der Grund: Ende 2024 haben sich die EU und die Schweiz im Grundsatz auf eine engere Kooperation geeinigt. Das wurde von den Befürwortern als Meilenstein in den oft komplizierten Beziehungen gefeiert, hat allerdings auch die Gegner auf die Barrikaden getrieben.
Das schwierige Verhältnis mit der Schweiz
Das Abkommen ersetzt mehr als 120 Einzelregelungen, die teils noch aus den 1990er Jahren stammen. Es umfasst unter anderem freies Reisen, Lebensmittelsicherheit und gleiche Wettbewerbsbedingungen. Das Abkommen muss aber noch von beiden Seiten ratifiziert werden. Auf der EU-Seite braucht es eine Zustimmung des Ministerrats, in der Schweiz ist eine Volksabstimmung nötig. Es könnte bis 2027 oder 2028 dauern, ehe das Gesamtpaket in Kraft tritt. Diese Zeit nutzen die Gegner des Abkommens für einen oft überaus aggressiv geführten Abwehrkampf. So ist die wählerstärkste Partei, die rechte SVP, gegen jede Annäherung. Sie spricht bei dem neuen Verhandlungspaket martialisch von einem „Unterwerfungsvertrag“. Die Partei argumentiert, dass ein enges Bündnis mit der EU die Schweiz Wohlstand kosten könnte und zudem mehr Migranten ins Land kommen könnten.
Die EU-Befürworter hegten die leise Hoffnung, dass der Zoll-Hammer von 39 Prozent, den die USA in diesen Tagen auf die Schweiz niedergehen ließen, die Stimmung beruhigen könnte – doch das Gegenteil ist der Fall. In den sozialen Medien läuft eine aufgeheizte, oft eher faktenfreie Kampagne der eidgenössischen EU-Gegner. Der Tenor lautet, auch wenn der große Rest von Europa nur 15 Prozent Zoll bezahle, dürfe sich die Schweiz nicht dem „Diktat aus Brüssel“ beugen. Die IBK räumt ein, dass in solch einer Stimmung die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht immer ein Zuckerschlecken sei.