Altersversorgung
Die fünf wichtigsten Fragen zur Rente
Von der Finanzierung bis zum Rentenalter: Es sind grundlegende Weichenstellungen nötig.
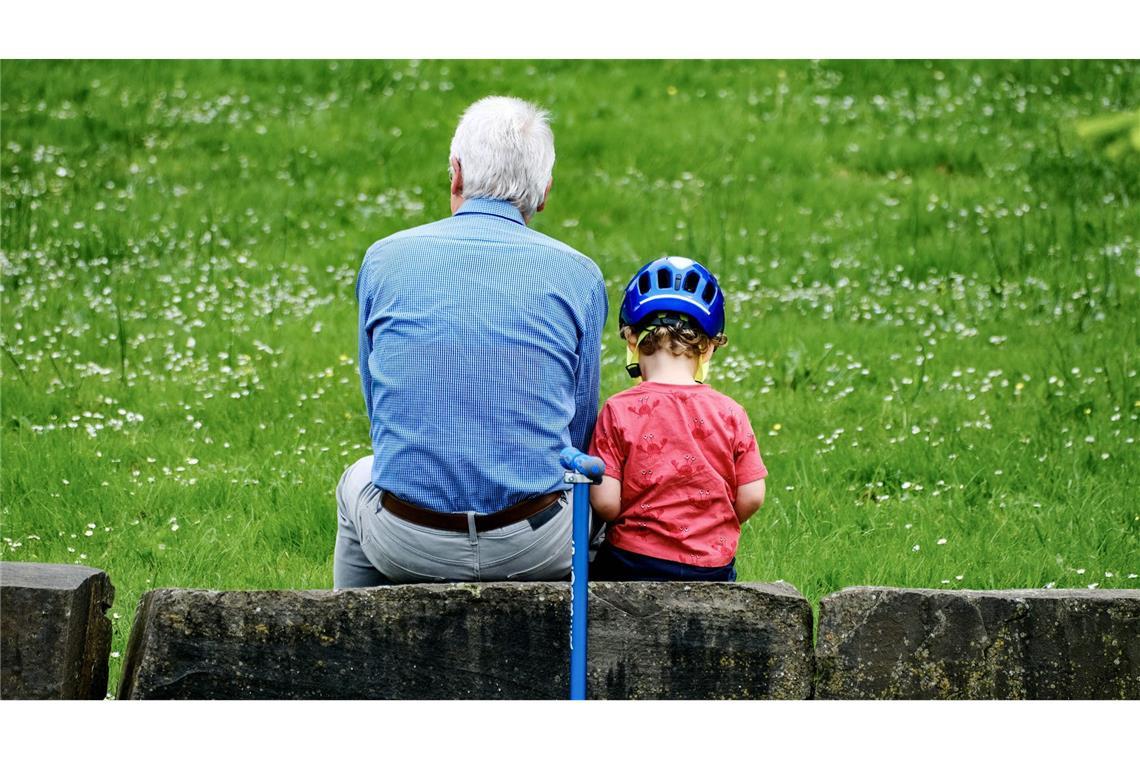
© IMAGO/Michael Gstettenbauer
Die Rente ist ein wichtiges Thema für Jung und Alt.
Von Tobias Peter
Schwarz-Rot hat sich in der Rentenpolitik im Koalitionsvertrag auf einige wenige Punkte geeinigt: zum Beispiel darüber, Anreize dafür zu setzen, dass Menschen von sich aus länger arbeiten. Einen großen Wurf in der Rentenpolitik plant auch diese Bundesregierung nicht. Dabei gibt es fünf entscheidende Fragen, die in der Rentenpolitik langfristig geklärt werden müssen. Ein Überblick.
Bleibt das Rentenniveau dauerhaft stabil?
Viele glauben, das Rentenniveau sei der Prozentsatz, den jemand von seinem letzten Lohn als Rente bekommt. Das ist aber falsch. Das Rentenniveau ist ein statistischer Wert, der das Verhältnis der Rente eines Durchschnittsverdieners nach 45 Beitragsjahren zum mittleren Lohn beschreibt. Die Idee hinter einem stabilen Rentenniveau ist also: Rentnerinnen und Rentner sollen gleichbleibend an dem gesellschaftlichen Wohlstand beteiligt sein, der Arbeitnehmern durch Lohnerhöhungen entsteht. Schwarz-Rot hat entschieden, das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 beim derzeitigen Stand von 48 Prozent zu stabilisieren. Würde dies nicht erfolgen, würden die Renten zwar nicht sinken, aber langsamer steigen. Gleichzeitig erfordert die beschriebene Rentengarantie wegen des demografischen Wandels hohe Steuerzuschüsse. Die Langfristfrage ist, ob die nächste Bundesregierung sich das noch leisten kann und will.
Wird das gesetzliche Renteneintrittsalter angehoben?
Wenn die Lebenserwartung steigt, liegt die Frage nahe, ob nicht ein Teil dieser Zeit auch in die Erwerbsarbeit gehen müsste. Experten schlagen das immer wieder vor. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich mehrfach für eine längere Lebensarbeitszeit ausgesprochen. Doch bräuchte es dann nicht Regelungen für diejenigen, die körperlich nicht mehr können? Und wie könnten die aussehen? Dennis Radtke, Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), also des Arbeitnehmerflügels der CDU, sieht die Diskussion noch aus einem weiteren Grund kritisch. „Wer ernsthaft über ein Renteneintrittsalter von 70 diskutiert, während im Jahr 2024 nur 40 Prozent der Arbeitnehmer überhaupt bis zur geltenden Regelaltersgrenze arbeiten, hat den Kompass verloren“, sagt er. Radtke fordert unter anderem „eine Unternehmenskultur, die Erfahrung nicht als Kostenfaktor betrachtet“.
Wie entwickelt sich der Beitragssatz?
Laut offiziellen Prognosen dürfte der Beitrag von heute 18,6 Prozent auf 18,9 Prozent im Jahr 2027 steigen. Ein Jahr später wären es dann schon 20 Prozent. Bis zum Jahr 2035 ist noch einmal von einem kräftigen Beitragsanstieg auszugehen. Im Kern ist diese Entwicklung nicht vermeidbar, da die geburtenstarken Jahrgänge nun nach und nach in Rente gehen. Die Frage ist eigentlich nur, ob durch rentenpolitische Maßnahmen noch zusätzliche Kosten – dann in der Regel für die Steuerzahler – dazukommen.
Kommt irgendwann die Aktienrente?
Die Rente ist ein Umlagesystem: Das, was an Beiträgen aus der arbeitenden Bevölkerung reinkommt, wird an die Generation im Ruhestand ausgezahlt. Da durch langfristige Kapitalanlage hohe Gewinne erzielt werden können, liegt der Gedanke nahe, dies auch für die Renten zu nutzen. Das hatte die Ampel ursprünglich in einem Gesetz geplant, das nicht mehr Realität wurde: Hierbei wäre geliehenes Geld am Kapitalmarkt angelegt worden – und der Gewinn hätte die Rente stabilisiert. Es gibt Länder, die einen Teil der Beiträge mittels eines öffentlichen Fonds in Aktien anlegen. Das könnte ein Weg sein, damit die breite Bevölkerung von Gewinnen am Kapitalmarkt profitiert.
Müssen auch Beamte in die Rentenversicherung einzahlen?
Die meisten, die keine Beamten sind, finden es ungerecht: Arbeitnehmer bekommen auch nach jahrzehntelangem Einzahlen überschaubar hohe Renten. Zahlen aus dem Bundesarbeitsministerium haben gerade gezeigt, dass 42 Prozent der Rentner weniger als 1000 Euro im Monat bekommen – was allerdings auch Personenkreise einschließt, die nur wenig eingezahlt haben. Dennoch sind die Pensionen viel besser. Andererseits gibt es zum Beispiel gerade bei den Polizeibeamten Lohngruppen, die wenig attraktiv sind – und bei denen die vergleichsweise gute Altersversorgung zu den überschaubar vielen Argumenten gehört, in den öffentlichen Dienst zu gehen.



