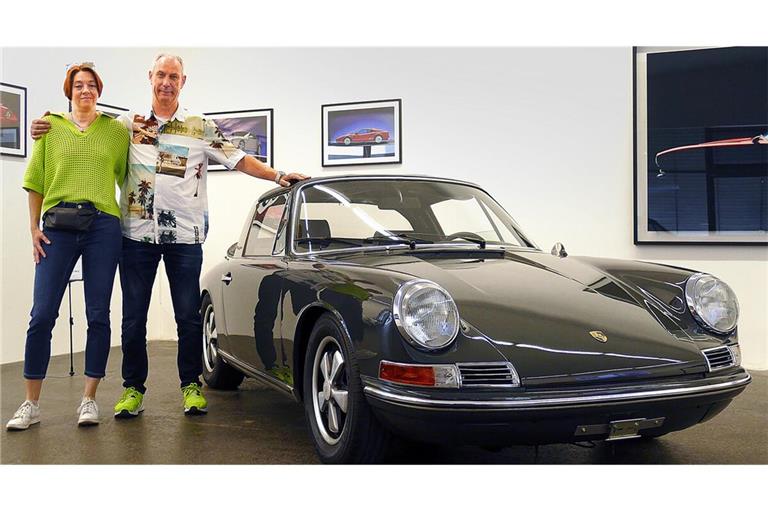Eine Ausstellung, die zu Herzen geht
Welche Erfahrungen haben türkische Gastarbeiter in Stuttgart gemacht? Und was empfindet die junge Generation? Das Stadtpalais widmet diesem Thema eine Ausstellung mit dem Titel „Stuttgart Hatırası“

© Deutsch-Türkisches-Forum
Aus einem Familienalbum: Rıza, ein türkischer „Gastarbeiter“ in den 1960er Jahren vor dem Fitz-Faller-Brunnen, der damals noch im Mittleren Schlossgarten stand.
Von Jan Sellner
Stuttgart - Es gibt Ausstellungen, die brauchen nicht viele Worte. Sie sind aus sich heraus verständlich, überzeugen durch ihr Thema und die Klarheit der Umsetzung. Eine solche Ausstellung ist seit Mittwochabend im Stuttgarter Stadtpalais zu sehen. Sie heißt „Stuttgart Hatırası“ – das türkische Wort für Erinnerung – und handelt von Menschen, die aus der Türkei als Gastarbeiter nach Stuttgart kamen, hier harte Arbeit verrichteten, Familien gründeten, Stuttgarter wurden, häufig jedoch nicht angekommen sind. Die Ausstellung bietet Raum für ihre persönlichen Geschichten, in denen sich eine große Gefühlsskala abbildet. Sie reicht von leidvollen bis zu schönen Erfahrungen an einem fremden Ort, der erst für die Nachkommenden zu einer Heimat werden sollte.
Persönliche Geschichten in 15 kleinen Erinnerungsräumen
Die Idee dazu stammt von Kerim Arpad, Geschäftsführer des Deutsch-Türkischen Forums. Die Geschichte der sogenannten Gastarbeiter ist für ihn ein „zentrales Kapitel der Stuttgarter Stadtgeschichte“, das es sichtbarer zu machen gilt. In Torben Giese, Direktor des Stadtmuseums, und Ausstellungsleiter Yannick Nordwald fand er Kooperationspartner, die sich mit großer Überzeugung hinter das Projekt stellten. Den Ausgangspunkt bilden Fotografien, wie sie in vielen Familienalben zu finden sind: Momentaufnahmen von Menschen an beliebten Orten in der Stadt – auf dem Schlossplatz, im Cannstatter Kurpark oder in der Wilhelma. In diesem Fall von jungen Türkinnen und Türkinnen, die hier Arbeit und eine Zukunft suchten. Die türkische Bezeichnung für solche Erinnerungsfotos lautet „Hatıra“. Zugleich steht der Begriff für eine Gefühlslage.
Im persönlichen Erleben liegt denn auch die Stärke von „Stuttgart Hatırası“. Im Ausstellungsraum im Erdgeschoss stehen 15 Erinnerungsräume. Kleine Kabinen mit hellen Vorhängen, in denen sich ein Stuhl und ein kleiner Tisch mit Tischdecke befindet. An der Wand hängt jeweils ein Foto der in der Ausstellung porträtierten „Gastarbeiter“ an einem bekannten Platz in Stuttgart. Daneben läuft ein Video, das die heutige Platzsituation zeigt. Auf dem Tisch liegt ein DIN-A4-Heft mit den persönlichen Geschichten. Sie sind das Ergebnis von Interviews, die die jungen Kuratorinnen Sema Ardıç, Dilay Ibis und Anthony Pool mit Vertretern der Gastarbeiter-Generation, ihren Kindern oder Enkeln geführt haben. Nicht zu vergessen, das Schälchen mit Lokum, einer traditionellen türkischen Süßigkeit, das ebenfalls zum Interieur dieser Erzählräume gehört.
Die Ausstellung hat auch einen Mittelpunkt: ein nachempfundenes Wohnzimmer, wo man sich über das Gesehene und Gelesene austauschen, eigene Geschichten hinzufügen und vor einer Fotowand neue Erinnerungsfotos machen kann – eine Reminiszenz an frühere Hatırası-Fotowände in der Türkei, die an Sehenswürdigkeiten aufgestellt waren. Um den intimen Charakter des Ausstellungsraums noch zu unterstreichen, stehen für die Besucher am Eingang Hausschuhe bereit. Denn wer würde eine fremde Wohnung mit Straßenschuhen betreten? Ein schönes Detail: Alle Möbel stammen vom Secondhandkaufhaus. Sie sind ausgeliehen und werden nach Ausstellungsende anderweitig verwendet.
Alt-OB Schuster: Stuttgart ist erfolgreich, weil es Einwanderungsstadt ist
Die von dem Duo Nazım Sabuncu und Tayfun Durak musikalisch begleitete Eröffnung am Mittwochabend gerät fulminant. Der Andrang ist enorm. Auffällig viele junge Menschen mit migrantischen Wurzeln sind gekommen. Erkennbar groß ist ihr Wunsch, die Geschichten zu lesen. Dabei stellen sie fest: Bei aller Unterschiedlichkeit der Biografien der Großeltern und Eltern gibt es viele gemeinsame Erfahrungen. Das gilt auch für „Gastarbeiter“ anderer Nationen. Kerim Arpad will diesem Aspekt im Begleitprogramm der Ausstellung Aufmerksamkeit schenken. Ziel sei es, „Brücken in der Stadtgesellschaft zu bauen“ – auch durch eine „inklusive Erinnerungskultur“. Für Museumsdirektor Torben Giese besteht eine Stärke der Ausstellung darin, dass sie deutlich macht, „wie sehr uns Stuttgart alle verbindet“. Und Alt-OB Wolfgang Schuster, der Kuratoriumsvorsitzender des Deutsch-Türkischen Forums ist, nimmt die Eröffnung zum Anlass für einen Appell. Es gehe darum, „Stuttgart gemeinschaftlich zu gestalten und nicht zu spalten“. Begriffe wie „Migranten“ wirkten abwertend. Für ihn ist klar: „Stuttgart ist erfolgreich und attraktiv, weil es eine Einwanderungsstadt ist.“
Zu den Jungen, die die Ausstellung an diesem Abend förmlich aufsaugen, gehören Batunan Aydemir und Rumeysa Akyol. Er ist 26, sie 22. „Das ist für uns ein wichtiges Zeichen von Gesehenwerden und Wertschätzung“, sagen die beiden. Zwei Begriffe, die bei der Eröffnung von „Stuttgart Hatırası“ häufig fallen. Klar, dass sie nach dem Rundgang ein Erinnerungsfoto vor der Fotowand im „Wohnzimmer“ machen.
Die Ausstellung ist bis zum 14. Dezember im Stadtpalais zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei.