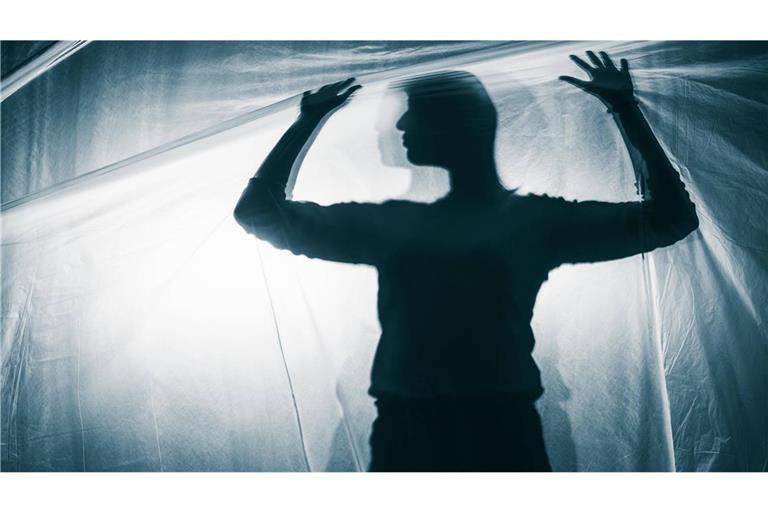Psychische Erkrankungen
Gibt es ein Depressions-Gen?
Was löst Depressionen aus – Gene, Krisen oder beides? Laut neueren Forschung könnten belastende Ereignisse wichtiger sein, als lange gedacht wurde.

© Imago/Imagebroker
Menschen mit Zwangsstörungen beschreiben das Ringen zwischen „zwei Gehirnen“ als besonders ausgeprägt.
Von KNA/Markus Brauer
Persönliche Erlebnisse könnten bei der Entstehung von Depressionen eine größere Rolle spielen als bislang angenommen. Ein „Depressions-Gen“, das die Erkrankung garantiert auslöse, gebe es laut neuesten Studien nicht, sagt die irische Neurowissenschaftlerin Claire Gillan.
Sie äußerte sich am Donnerstagabend (20. November) bei der Ringvorlesung „Gesundheit und soziale Teilhabe“, die die Medical School Hamburg organisiert.
Einfluss äußerer Umstände
Lange sei man davon ausgegangen, dass ein Mangel an Serotonin für die Entstehung von Depressionen verantwortlich sei, erklärte die Professorin des Trinity College in Dublin.
Inzwischen deute die Forschung jedoch darauf hin, dass äußere Umstände massiven Einfluss auf die Erkrankung hätten. Vor allem dann, wenn die Zahl belastender Ereignisse besonders hoch sei. Darauf deuteten auch viele Berichte von Betroffenen hin.
Zwischen Planung und automatisierter Reaktion
Grundsätzlich unterscheide man zwischen zielorientiertem Denken und dem Reiz-Reaktions-Modell, erläutert Gillan. Dies beschrieb bereits der 2024 verstorbene israelische Psychologe Daniel Kahneman.
Zielorientiertes Denken brauche man für Planung und vernünftige Entscheidungen, die oft Kraft kosteten, betont die Expertin. Zugleich sei das Reiz-Reaktions-Modell für alltägliche Effizienz unabdingbar, da darüber etwa automatisierte Handlungen wie das Autofahren abliefen.
Ringen zwischen „zwei Gehirnen“
Menschen mit Zwangsstörungen beschrieben das Ringen zwischen „zwei Gehirnen“ als besonders ausgeprägt: Ein rationaler Teil sage ihnen etwa, dass es unnötig sei, erneut zu prüfen, ob der Herd wirklich ausgeschaltet ist. Der andere, dass sie dies unbedingt tun müssten. Grundsätzlich brauche es aber eine Balance, konstatierte die Expertin: „Eine Art zu denken ist nicht besser als die andere.“
Das gelte auch für andere neurobiologische Unterschiede. So betrachte man etwa Autismus inzwischen dann als behandlungsbedürftig, wenn sich Menschen beeinträchtigt fühlten oder in Not gerieten und nicht grundsätzlich als Störung. Nicht nur in Fachkreisen, auch in der Gesellschaft gebe es inzwischen mehr Verständnis dafür, sagte Gillan.