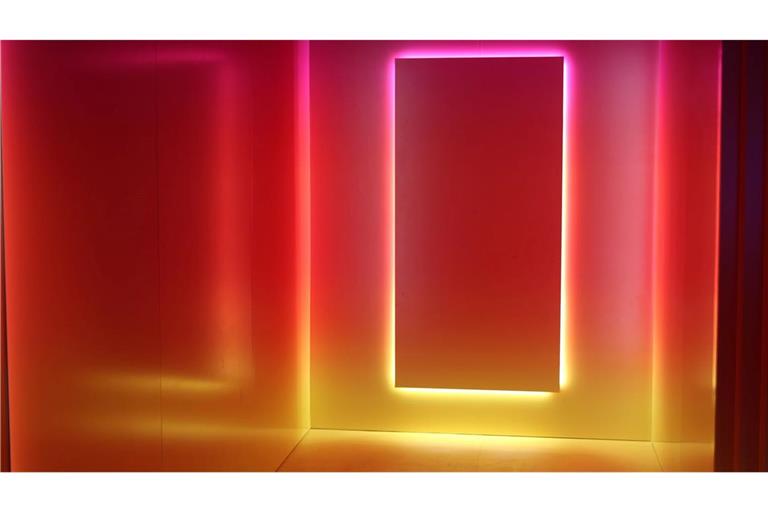Alarmierende Zunahme
Mehr Methan-Quellen: Steht die Antarktis vor dem Klima-Kollaps?
Vor der Küste der Antarktis tritt immer mehr des potenten Treibhausgases Methan aus. Dies deutet auf einen grundlegenden Wandel der antarktischen Meeresumwelt hin.

©
Dieser Tauchroboter hat gerade einige neu entstandenen Methanquellen am Grund des antarktischen Rossmeers entdeckt. Erkennbar sind sie an den weißlichen Bakterienmatten.
Von Markus Brauer
Ob vor Helgoland, vor der US-Ostküste oder im Pazifik: In vielen Meeresgebieten weltweit tritt Methangas aus dem Untergrund aus. Meist wird dieses potente Treibhausgas von Gashydraten im Meeresgrund freigesetzt. Diese gefrorene Verbindung aus Methan und Wassereis kann bei Erwärmung oder Druckentlastung zerfallen und ihre Gasfracht abgeben.
Besonders große Mengen im Untergrund eingefrorener Methanvorkommen gibt es in den Polargebieten. Werden sie frei, könnte dies den Klimawandel zusätzlich anheizen.
Während in der Arktis schon zehntausender solcher Methanquellen gefunden wurden, ist bisher unklar, wie viele es davon in antarktischen Gewässern gibt. Und ob solche Gasaustritte dort mehr werden.
Aufsteigende Blasen und Bakterien
Jetzt gibt es beunruhigende Nachrichten aus dem antarktisches Rossmeer: Ein Team um die Meeresforscherin Sarah Seabrook von Earth Sciences New Zealand in Newmarket hat dort durch Zufall zahlreiche neu entstandene Methanquellen entdeckt. Die Studie ist im Fachjournal „Nature Science“ erschienen.
Bei Tauchgängen und akustischen Messungen im McMurdo Sound und vor weiter nördlich gelegenen Küstenabschnitten stießen sie auf zahlreiche Stellen, an denen Blasen vom Meeresgrund aufstiegen. An anderen Stellen zeigten weißliche Bakterienmatten die Methanquellen an.
„In diesen gut untersuchten Arealen gab es zuvor keine Anzeichen für solche Methanquellen. Jetzt haben wir dort zahlreiche neue Fluid- und Gasaustritte entdeckt“, berichten die Forscher. Ihren Schätzungen zufolge können diese Methanquellen erst in den letzten Jahren neu entstanden sein. Die Austritte liegen zwischen zehn und 240 Meter unter der Meeresoberfläche.
Gashydrate und andere Methanquellen in Polargebieten
Unter vielen Gletschern der Arktis und Antarktis sowie im Meeresgrund gibt es Gashydrate (GH). Solange sie vom Eis belastet und gefroren sind, bleiben sie stabil. Doch diese Gashydrat-Stabilitätszone (GHSZ) schwindet beim Gletscherrückzug. Auch der sich erwärmende Meeresgrund kann dann Methan freisetzen.
Nach Ansicht von Seabrook und ihrem Team geben diese Funde Anlass zu großer Sorge. „Durch diese Methanaustritte besteht das Potenzial eines schnellen Transfers von Methangas in die Atmosphäre. Und das aus einer Quelle, die bisher in unseren Klimawandelszenarien nicht berücksichtigt wurde“, erläutert Seabrook.
Denn während das Methan aus Quellen in der Tiefsee meist noch im Sediment oder dem darüberliegenden Meerwasser abgebaut wird, liegen die antarktischen Methanquellen nahe an der Wasseroberfläche. „Videos unseres Tauchroboters von einer Methanquellen-Stelle vor Cape Evans zeigen Gasblasen, die vom Meeresgrund aufsteigen und sich an der Unterseite des Meereises sammeln“, berichtet das Team.
Das demonstriert, dass dieses Gas nicht im Meer bleibt, sondern bis in die Atmosphäre aufsteigen kann. Angesichts der großen im Untergrund der antarktischen Küstenregionen vermuteten Methanvorkommen könnte dies eine bisher unterschätzte Klimagefahr darstellen.
Das Problem mit dem Methan
Methan ist nach Kohlendioxid (CO2) das zweitwichtigste Treibhausgas, seit Beginn der industriellen Revolution hat es nach Schätzungen zu etwa 30 Prozent zur Klimaerwärmung beigetragen. Es ist ein sehr wirksames Treibhausgas: Auf 20 Jahre gerechnet ist es rund 85 Mal so klimawirksam wie CO2.
Etwa 60 Prozent des Methans in der Atmosphäre gehen auf menschlichen Einfluss zurück. Etwa 40 Prozent dieser Emissionen entstehen der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge in der Energiewirtschaft.
Während CO2 aber hunderte oder mehr Jahre in der Atmosphäre bleibt, baut sich Methan nach etwa zwölf Jahren langsam ab. Wenn der Ausstoß verringert wird, wäre der Beitrag zur Eindämmung der klimaschädlichen Treibhausgase schnell deutlich spürbar. Das könnte laut Experten ein wichtiger Beitrag zur Einhaltung des Ziels sein, die Erwärmung möglichst unter 1,5 Grad über vorindustriellem Niveau zu halten.
„System verändert sich rapide vor unseren Augen“
„Wenn in dieser Region weiterhin so viele neue Methanquellen entstehen, wirft dies die Frage auf, wie die flachen Küstengebiete der Antarktis in fünf oder zehn Jahren aussehen werden“, erklärt Seabrook. „Dieses System verändert sich rapide vor unseren Augen.“ Das Team befürchtet, dass diese zunehmende Methanausgasung einen fundamentalen Wandel der antarktisches Meeresumwelt anzeigen könnte.
Es sei nun dringend nötig, diese Entwicklung auch in anderen Regionen der antarktischen Küstenregionen genauer zu untersuchen, betonen die Forschenden. Denn nur so sei es möglich, die weitere Entwicklung und die genauen Mechanismen dieser Methanfreisetzungen zu ergründen.