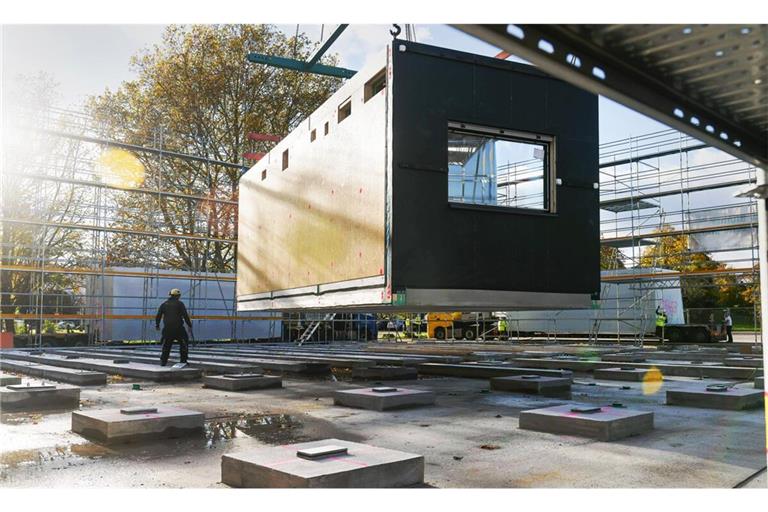Neue Schau: Wie jüdisch ist Deutsch?
Die Ausstellung „Schlamassel Tov“ im Stuttgarter Rathaus macht mit einer Lektion in Jiddisch die vielfältigen kulturellen Verflechtungen bis hin zu sprachlichen Einflüssen mit dem jüdischen Leben deutlich.
Von Heidemarie A. Hechtel
Stuttgart. - Das Vermögen verzockt, mit der Gattin gezofft und dann auch noch beschickert das Auto zu Schrott gefahren: Was für ein Schlamassel. Sein Nachbar dagegen: Ein Sechser im Lotto. So ein Massel! Man könnte auch von Glück oder Pech reden. Aber die deutsche Sprache steckt von A wie Abzocken bis Z wie Zoff voller Wörter, die aus dem Jiddischen stammen. Wie jüdisch ist also Deutsch? Eine Antwort auf diese Frage gibt die Ausstellung „Schlamassel Tov“ im Foyer des Rathauses.
Das Massel ist der Glücksstern, das Schlamassel ein Dilemma, Pech und Unglück. Authentisch oder zurecht geschliffen wurden sie seit Jahrhunderten in den deutschen Wortschatz übernommen und sind der Beweis für die engen kulturellen Verflechtungen mit dem jüdischen Leben. Denn wir benutzen sie ganz selbstverständlich. Das zeigt auch die Ausstellung im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen und als Bestätigung ihres Mottos „Mitten dabei“. „Jetzt aber mal tacheles“ steht in blauen Lettern vor pinkfarbenem Hintergrund auf einem der zehn Plakate in unübersehbar großem Format. Ergänzt in kreideweißer Handschrift mit dem Wort tachlis, der jiddischen Bezeichnung für Endzweck, Vollkommenheit. „Bloß kein Zoff“, ein weiteres Motiv, braucht keine Übersetzung, das Wort für Ärger, Streit und Zank kommt aus dem hebräischen Wort für mieses Ende. Dagegen ist der Zorres, hier als Süßes oder Saures übersetzt, ein fast harmloser Ärger.
Wer malocht, übernommen von melochnen für arbeiten, braucht auch mal ein Sabbatical, eine längst übliche Anleihe in Englisch vom Schabbatjahr. Stuss (Schtus für Unsinn und dummes Zeug) soll man nicht labern und jeden Schmu (Schmuo für Gerede und Geschwätz) nicht glauben. Dreiste Unverschämtheiten lassen sich am treffendsten als „Chuzpe“, jiddisch chuzpo, anprangern. Das Kompliment, jemanden dufte zu finden, hat rein gar nichts mit Wohlgerüchen zu tun, sondern mit dem Wort toffte für wunderbar und toll. Und auch das Kaff, meist abschätzig gebraucht für ein Kuhdorf und das allerletzte Langeweiler-Nest, kommt ganz wertfrei vom hebräischen Wort kefar für Dorf.
Mischung aus Deutsch und Hebräisch
Soweit die kurze Lektion in Jiddisch, die nur einen Bruchteil des entsprechenden Vokabulars darstellt. Wer neugierig geworden ist und seinen Wortschatz daraufhin überprüft, hat Aha-Erlebnisse: Dass die Pleite von pleto, dem Ausdruck für die Flucht vor Gläubigern kommt, der Hals- und Beinbruch die Verballhornung von hasloche und broche, Erfolg und Segen, darstellt, und betucht auf betuch für sicher zurückgeht. Jiddisch ist im Mittelalter entstanden. Anfang des 13. Jahrhunderts durften Juden in Deutschland nur in Ghettos wohnen. In dieser Isolation mischten sich hebräische und deutsche Sprache zu einem Dialekt, der sich auch nach Osteuropa ausbreitete, slawische Einflüsse übernahm, dort zu einer autonomen Sprache geworden ist und vor allem in der Schtetl-Kultur zuhause war.
„Doch es geht um mehr als Worte“, sagt Maria Ernst von der Kultur-Region Stuttgart, die diese Plakat-Kampagne als Teil und Abschluss des auf zwei Jahre angelegten Projektes „Jüdisches Leben in der Region Stuttgart“ entwickelt hat. „Jüdinnen und Juden prägen seit mehr als 1700 Jahren als Teil der Kulturlandschaft Mitteleuropas Wissenschaft, Kunst, Politik und besonders die Sprache“, so Maria Ernst. „Wir wollten zeigen, wie Sprache zum Spiegel geteilter Geschichte wird. Und die Neugier darauf wecken.“ Die Motive, grafisch gestaltet von der Agentur Niessner Design, habe man in einem offenen kreativen Prozess entwickelt.
Hintergründige, tiefsinnige, poetische und sehr persönliche Texte verschiedener Autoren zu den einzelnen Begriffen ergänzen die Ausstellung. „Zorres“, schreibt Ramona Ambs, „kann jedem mal passieren.“ Aber sein Zwilling sei Riesches, was dem deutschen Wort Bosheit entspreche. Und im Jiddischen nichts anderes als Antisemitismus bedeute. „Mach mir kein Zorres und kein Riesches, pflegte meine Großmutter zu sagen, wenn ich das Haus verließ.“ „Dufte find ich Dich. Und schnieke und schejn“, macht Lior Smith, wem auch immer, eine Liebeserklärung.
Mit dem Widerspruch leben
Und Debora Antmann liefert die Erklärung für den scheinbar widersprüchlichen Titel der Ausstellung, wenn sie über ihr Jüdisch-Sein nachdenkt: „Was ist das Jüdische an mir, wenn ich nicht religiös bin, nicht Hebräisch sprechen, am Samstag arbeite und Schwein esse? So ein Schlamassel.“ Und kommt zu dem Schluss: „Es sind die jüdischen Wurzeln, die mich fest in meiner Welt verankern. Mein Jüdisch-Sein: Schlamassel-Tov.“ Ein Dilemma, aber ein gutes?
„Tov“, das hebräische Wort für gut, zeigt, dass genau in dieser gegenseitigen Prägung das Schöne liegt,“ klärt der Publizist Robert Ogmann im Begleittext auf. „Es steht für diese komplexe, manchmal chaotische, aber untrennbare Verbindung – eine Verflechtung, die nicht auflösbar ist.“ Das gilt nicht nur für die Sprache.
Weitere Informationen
Ausstellung Die Schau „Schlamassel Tov“ im Foyer des Stuttgarter Rathauses dauert bis zum 16. November.
Online Die Begleittexte sind über die QR-Codes oder auf www.kulturregion-stuttgart.de zu finden.