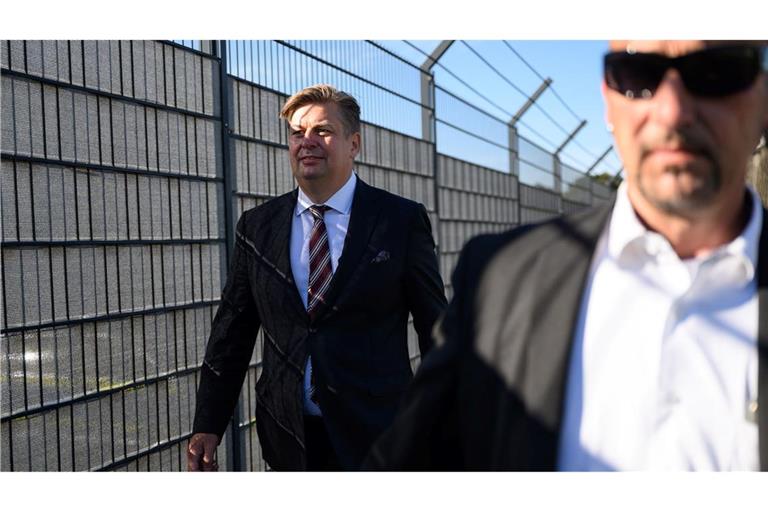AfD und Verfassungsschutz
Öffentlichkeit hat Recht auf Wissen
Das Gutachten zur AfD ist nun bekannt. Das ist gut so. Die Geheimniskrämerei ist eine Steilvorlage für Verschwörungstheorien, kommentiert Christian Gottschalk.

© dpa/Carsten Koall
Die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet.
Von Christian Gottschalk
Die Journalisten des Magazins Cicero sind keine kleinen Julian Assanges. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks hatte seinerzeit mutmaßliche Kriegsverbrechen des US-Militärs im Irak und in Afghanistan enthüllt – und dieses Engagement teuer bezahlt. Jahrelang lebte er als Flüchtling in der ecuadorianischen Botschaft in London, jahrelang saß er dort im Gefängnis. All das droht den Cicero-Machern nicht, nachdem sie das Gutachten des Verfassungsschutzes veröffentlicht hatten, in dem dieser die AfD als rechtsextreme Partei bewertet hatte. Das Material ist auch weit weniger brisant.
Steilvorlage für Verschwörungstheorien
Gleichwohl war um das mehr als 1000 Seiten starke Papier zuvor stets ein großes Geheimnis gemacht worden. Die Verfassungsschützer teilten ihre Erkenntnisse gerade einmal mit dem ihnen übergeordneten Innenministerium. Diese Geheimniskrämerei ist nun Geschichte. Das war schon lange überfällig, den Journalisten gehört ein großer Dank.
Die Beziehung der Verfassungsschutzämter mit der so genannten Alternative für Deutschland ist so lang wie schwierig. Neben dem Bundesamt beobachten zahlreiche Landesämter die Partei, mal als Ganzes, mal in Teilen, mal einzelne Personen. Mancherorts wird die Partei als rechtsradikaler Verdachtsfall eingestuft, mal als gesichert rechtsextrem. In praktisch jedem Fall behalten die Verfassungsschützer die genauen Gründe für ihre Einschätzung für sich. Selbst Gerichte müssen zum Teil mit geschwärzten Akten arbeiten, wenn sie die Ergebnisse überprüfen. Die Gesetze mögen das hergeben, doch die Regeln, nach denen vorgegangen wird, passen nicht auf den Anlass. Wenn es darum geht eine der größten Oppositionsparteien zu beobachten, dann ist Transparenz von Nöten. Mit der übertriebenen Geheimhaltung erweisen die Ermittler dem Verfahren einen Bärendienst. Das bisherige Vorgehen ist eine Steilvorlage für all jene, die ohnehin ganz gerne von Geheimjustiz faseln.
Manchmal braucht es Hintergrundwissen
Zugegeben: ganz einfach zu lesen ist die Quellensammlung nicht immer, die da von den Ämtern zusammengetragen wurde. Da das Parteiprogramm der AfD keinen gerichtsfesten Anlass dafür bietet, die Staatstreue der Partei in Zweifel zu ziehen, werden Zitate ihrer Vertreter gesammelt, die das belegen sollen. Manch ein harmlos scheinender Ausspruch hat dabei eine geschichtlich belastete Vergangenheit, die nicht für jedermann offensichtlich zu Tage liegt. Doch das spricht nicht gegen eine Veröffentlichung. Im Bericht wird das auch so angesprochen.
Das Gutachten hat Zitate von mehr als 350 Vertretern der Partei zusammengetragen. Mal menschenverachtend, mal aggressiv, mal verschwörungstheoretisch. Es finden sich auch Äußerungen, die eher skurril denn verfassungsfeindlich wirken. Das sammeln von Zitaten ist das eine, das Bewerten von ihnen etwas anderes. Es liegt in der Natur der Sache, dass die AfD dabei zu einem anderen Ergebnis kommt als ihre Kritiker. Der Rechtsstaat sieht vor, dass letztendlich die Gerichte entscheiden werden. Das ist gut so. Es ist aber auch gut, dass sich die bei diesem Thema hoch interessierte Öffentlichkeit ein Bild davon machen kann, worauf die Argumente letztlich fußen.
Keine Regel, sondern die Ausnahme
Das hilft auch, um bisherige Verteidigungsstrategien der AfD zu hinterfragen. Immer wieder hatte die Partei auf Landesebene behauptet, dass kritische Äußerungen von Menschen stammten, die schon lange nicht mehr Mitglied wären. Solche Äußerungen gibt es auch in dem aktuellen Gutachten wieder. Sie bilden aber nicht die Regel, sondern die klare Ausnahme. Das ist keine Interpretation, sondern kann ganz einfach mit Durchzählen ermittelt werden.