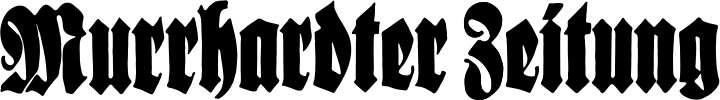Städel Frankfurt: Beckmann
Wer ist dieser Max Beckmann?
Der Maler Max Beckmann ist weltberühmt. Aber was für ein Mensch war er eigentlich?

© Städel Museum, Dauerleihgabe Sammlung Karin & Rüdiger Volhard
Ausschnitt aus Max Beckmanns Aquarell „Der Mord“ von 1933
Von Adrienne Braun
Es ist die vermutlich unwichtigste Frage, die man im Museum stellen kann: War dieser oder jener Künstler eigentlich sympathisch? Die Werke sollen für sich sprechen. Und bei Max Beckmann ist ohnehin längst der Beweis erbracht worden, dass er einer der bedeutendsten Künstler der Moderne war. Er hat, heißt es gern, die Zerrissenheit der Welt in einer eigenständigen Formensprache zum Ausdruck gebracht. Wie er als Mensch tickte, gilt der Forschung deshalb als irrelevant.
Und doch drängt sich die Frage förmlich auf, wenn man nun durch die Ausstellung im Frankfurter Städel läuft, die sich auf Papierarbeiten konzentriert, weil Beckmanns stetes Zeichnen im Grunde dem Selbstgespräch in einem Tagebuch entsprach. Gut und gerne 2000 Zeichnungen entstanden im Lauf der Jahre, auf denen er festhielt, was er sah und erlebte. Zugleich verraten die Blätter auch, wie er sich künstlerisch entwickelte und wie er auf die Welt blickte.
Und dieser Blick war oft kritisch und skeptisch – was man vor allem an seinen vielen Selbstporträts ablesen kann. 1912, da war er gerade 28 Jahre alt, zeichnete er sich und wirkt mit Hemd, Binder und vor allem dem ernsten Blick deutlich älter. Dabei liefen die Dinge nicht schlecht für ihn. Nachdem er in Weimar Kunst studiert hatte, ging er nach Paris, dann nach Berlin, wo er heiratete, Vater wurde und 1913 bereits eine erste Einzelausstellung bei Paul Cassirer hatte. Er wolle „das ganze pulsierende fleischliche Leben“ einfangen, erklärt er – was er mitunter auf recht voyeuristische Weise tat: An der „Gefangenen“, die er 1910 skizzierte, interessierten ihn unübersehbar der ausgelieferte nackte Leib und die prallen Brüste, die er ins Zentrum rückte. Er wählte klar die Täter- und nicht die Opferperspektive.
Dokumentarisches Interesse
Wie so viele junge Leute und gerade auch Künstler, wollte Max Beckmann bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs seinen Beitrag leisten und meldete sich zum Sanitätsdienst. In Lazaretten in Belgien musste er allerdings bald feststellen, dass der Krieg nicht so rühmlich ist, wie ihn sich viele dieser jungen Leute in ihrer Euphorie naiv vorgestellt hatten. Auch hier hielt Max Beckmann das Gesehene in Zeichnungen fest.
In der Frankfurter Ausstellung sind Blätter aus dem Buch „Kriegslieder“ zu sehen, etwa die belgische Landschaft, die von Schützengräben durchzogen ist. Er zeichnete einen aufgebahrten Toten, der fast lässig seine nackten Füße überkreuzt hat. Auch an den „Maroden Soldaten“ interessierte Beckmann weniger das Schicksal dieser Männer, stattdessen wirken sie wie anonyme Gestalten in langen Mänteln und mit großen Gewehren. Den verwundeten Soldaten mit Kopfverband scheint er ebenfalls aus rein dokumentarischem Interesse festgehalten zu haben.
Man kann sich schon fragen, was für ein Mensch hinter diesen Bildern stand, die oft teilnahmslos wirken. Ende 1915 wurde Beckmann aus gesundheitlichen Gründen beurlaubt. Er kehrte aber nicht zu seiner Familie zurück, sondern zog zu Freunden nach Frankfurt am Main. Fortan scheint er versucht zu haben, sich den Krieg mit Lebenshunger vom Leib zu halten, hielt Besuche in der Oper und im Theater fest, ging ins Varieté und auf den Jahrmarkt. Aber das Vergnügen hat bei ihm einen galligen Beigeschmack. „Die Hölle“ nannte er eine Folge von Lithografien, bei der er Elend und Verrohung der Zeit zeigen wollte – in verwirrend verschachtelten Straßenszenen.
Wo steckt die Anteilnahme?
Die Ausstellung im Städel lenkt den Blick auf die stilistischen Veränderungen. In den 1920er Jahren verändert sich sein Strich; statt Figuren mit Schatten plastisch zu modellieren, konturiert er sie nun mit klarem, selbstbewusstem Strich. Er wählt ungewöhnliche Perspektiven. Die „Zwei Frauen“ auf einem Doppelporträt hat er getrennt gemalt, dann aber so eng zusammen ins Bild gepresst, als würde die eine der anderen auf dem Schoß sitzen. Es waren erfolgreiche Jahre, Beckmann hatte Einzelausstellungen und seine Werke wurden sogar von Museen angekauft. Er knüpfte gezielt Kontakte in die großen Kunstzentren Berlin, New York, Basel und Paris, wohin er 1929 seinen Hauptwohnsitz verlegte.
Und dann der Einbruch durch die Nazis: Beckmann, der in Frankfurt gelehrt hatte, wird entlassen, 1937 werden seine Werke bei der Aktion „Entartete Kunst“ beschlagnahmt. Er emigriert nach Amsterdam – und erhält 1948 endlich ein Visum für die USA, wo er schon vorher hatte hinziehen wollen. Auf seinem „Selbstbildnis mit Fisch“ von 1949 sieht man Beckmann mit Hut und Holzfällerhemd, aber sein kantiges Gesicht verrät eine Statur, die wohl eher nicht zum Cowboy taugte. Nach einem Besuch eines Rodeos zeichnet er den Reiter, der Hals über Kopf durch die Luft fliegt. In Chicago skizziert er aus seinem Fenster heraus fasziniert die Hochhäuser dieser neuen Welt.
In deren Kunstszene fasste er schnell Fuß, auch wenn Beckmann, inzwischen Mitte sechzig, weiter figürlich malte, während die jüngere Generation die Abstraktion für sich entdeckte. Beckmann, heißt es in der Ausstellung, habe stattdessen die Wahrheit hinter dem Sichtbaren gesucht. Und das tut man letztlich als Besucher auch und staunt, dass in Beckmanns gezeichneten Tagebuchnotizen immer wieder Gewalt auftaucht – ohne jedes Anzeichen von Anteilnahme.
Zeichnen statt schreiben
TagebuchMax Beckmann hielt alles, was ihn umgab in Zeichnungen fest, führte aber auch Tagebuch. Einen Großteil dieser Aufzeichnungen verbrannte er allerdings, als die deutschen Truppen 1940 in den Niederlanden einmarschierten, wo er Zuflucht gesucht hatte.
Ausstellung„Beckmann“ ist bis 15. März im Städel in Frankfurt zu sehen und von Di bis So von 10 bis 18 Uhr und Do 10 bis 21 Uhr geöffnet. adr